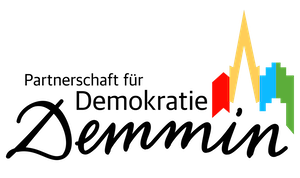Kinder unterschiedlichen Alters trafen aus zwei verschiedenen Schulen an einem Ort außerhalb ihrer Lernorte aufeinander.
Das gemeinsame Ziel: Theater spielen!
Aber wie sollte das gehen, wie mit Menschen umgehen, die sich fremd waren, an einem Ort, der allen fremd war?
Um gemeinsam Theater zu spielen, traten die Camp-Teilnehmenden in Kontakt miteinander, lernten sich kennen, tauschten verschiedene Ideen aus und kommunizierten über diese. Sie erfuhren Toleranz und Kompromissbereitschaft und probierten diese aus. Im Rahmen der viertägigen Camp-Woche ließen sie gemeinsam Theaterszenen entstehen, und auch ihre theaterfreien Campzeiten gestalteten die Kinder und Jugendlichen miteinander. Und vor allem: In welchem Zustand reisten die Kinder an und wieder ab? Was trennte, was verbindete, was hatte sich in vier Tagen verändert?
Wichtig war den Antragstellenden der Weg – das heißt, der Prozess, den die Kinder durchlebten. Die gesellschaftliche und politische Lage war ernst. Angst vor Veränderung, vor Verlust, der hohe Zuspruch zu rechten Parteien, die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich – all das zeichnete sich deutlich ab. Nach drei Jahren Corona-Pandemie ging man geräuschlos zur Tagesordnung über, obwohl besonders Kinder und Jugendliche die Geschehnisse noch nicht ansatzweise verarbeitet hatten.
Neuem und Fremdem begegnete man mit Misstrauen und Ablehnung. In diesen Zeiten des Umbruchs und der Unsicherheiten hielten die Antragstellerinnen kreativen Austausch und soziale Begegnungen für dringend erforderlich, um erfolgreiche Demokratiebildung zu betreiben.